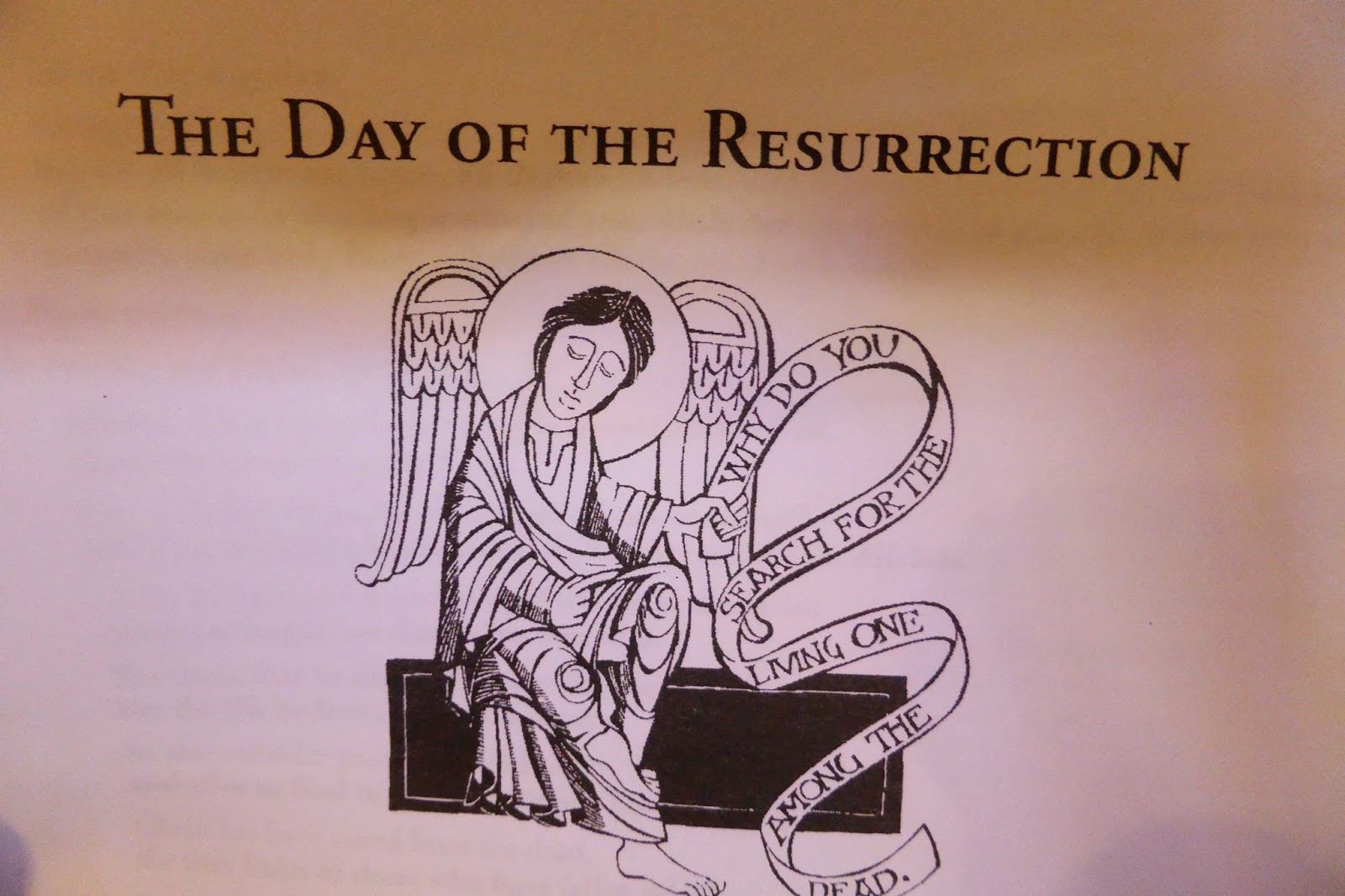Vom Kulturschock im
Allgemeinen habe ich bereits geschrieben. Jeden Tag fallen mir aber
seit unserer Ankunft viele kleine Details auf, die das Leben hier vom
deutschen unterscheiden. Die ganz auffälligen Unterschiede lasse ich
an dieser Stelle mal unerwähnt, aber meinen Lesern will ich meine
Beobachtungen im Kleinen nicht vorenthalten. (Manche Dinge nerven
mich, andere finde ich nachahmungswert und manche sind
einfach anders, als ich es gewohnt bin.)
 |
| Eine amerikanische Flagge im Vorgarten unserer Nachbarn. |
Hier eine
unvollständige Liste:
Das Essen ist im
Allgemeinen süßer hier. Auch die meisten Brotsorten enthalten
Zucker oder Honig.
Brot ist auch luftiger und
wird viel schneller hart als in Deutschland. Es ist nicht dazu
gedacht, es mit Wurst und Käse zu belegen wie daheim. Eher isst man
es zur Mittagssuppe. Oder man belegt sich ein Sandwich, aber dann
handelt es sich meistens um (lappiges) Toastbrot.
Roggenmehl (und damit auch
Roggenbrot) ist hier schwer zu finden. Die Amerikaner essen vor allem
Weizen- und Maisprodukte.
Im Gegensatz zum deutschen
Schweinefleisch, wird (außerhalb der Südstaaten) vor allem Rind gegessen. Denn in den USA brauchte man keine Abfallfresser wie im dichtbesiedelten Europa, und
es gab natürlich im wilden Westen immer genügend Platz für Weideflächen.
Milch und vor allem
Naturjoghurt enthalten in der normalen Form wesentlich mehr Fett als
bei uns. Wer weniger Fett will, muss „low fat“ oder „no
fat“-Produkte kaufen, bei denen wiederum der Geschmack leidet.
Beim Lebensmitteleinkauf
muss ich immer sehr auf die verschiedenen Gewichts- und
Flüssigkeitsmengenangaben achten. Bei Gemüse und Obst ist hier
natürlich der Preis pro „pound“ (Pfund) angegeben. Das ist
weniger als ein halbes Kilo, aber ich falle immer noch drauf rein und
denke, das ist aber billig!
Lebensmittel sind aber um
einiges teurer als in Deutschland, vor allem Grundnahrungsmittel wie
Milch, Mehl und Zucker. Ich habe einige Zeit überlegt, warum. Dann
ist mir ein Licht aufgegangen: Hier wird die Landwirtschaft nicht so
immens subventioniert wie in der Europäischen Union! Das ist bei uns
so selbstverständlich, dass es mir gar nicht mehr auffällt.
Die Mehrwertsteuer (in
Kalifornien neun Prozent) wird hier erst an der Kasse zur Rechnung
dazu addiert. Der Preis wird im Laden immer ohne Mehrwertsteuer ausgezeichnet. Zum Glück nicht bei Lebensmitteln, denn ich staune
schon manches Mal über die Endsumme.
Wer den Bus nimmt, bedankt
sich beim Aussteigen beim Busfahrer für die Fahrt. Das finde ich
wirklich nett, vor allem weil ich inzwischen auch einige Busfahrer
gut kenne, die regelmäßig unsere Linie durch die Berge bugsieren.
Die Amerikaner sind im
Allgemeinen sehr freundlich. (Aber natürlich nicht alle, es gibt
auch mal grummelige Kassierer oder schlecht gelaunte Busfahrerinnen.)
Wenn man allerdings von anderen überschwenglich begrüßt wird und
einem die Frage gestellt wird: „How are you doing?“, soll man
nicht wirklich erzählen wie es einem geht. Man sagt entweder „Good.“
oder „Great.“ oder noch besser: „How are you doing?“ (Für
mich fühlt sich das manchmal an wie Lügen, besonders wenn es mir
gerade wirklich nicht gut geht. Aber ich sage trotzdem: „Good.“)
Amerikanisches Englisch
ist nicht nur eine andere Sprache. Auch die verschiedenen Nuancen
müssen wir, wie bei jeder anderen Fremdsprache auch, neu erlernen.
Sage ich, dass ich etwas mag („I like it.“), klingt das für
Amerikaner eher fad. Dagegen erscheint mir das amerikanische „I
love it.“ oft schon übertrieben. Aber hier muss eben alles etwas
spektakulärer sein als zu Hause. Wenn etwas toll ist, umschreibt man
es am besten als „great“ (großartig), „awesome“
(fantastisch) oder „gorgeous“ (umwerfend).
Auch die
Kinderunterhaltung, das Spielzeug, Süßigkeiten etc. sind hier in
der Regel knalliger, bunter und lauter. Rosa Osterhasen mit Glitzer?
Kein Problem! Das heißt nicht, dass es hier keine Alternativen zu
dem Knalligen gibt, die sind nur schwerer zu finden. Zum Glück
sticht Berkeley als liberale Hochburg und Sammelbecken für
Andersdenkende auch an dieser Stelle heraus.
Wer europäische Cafés
mag, wird in den USA nicht wirklich fündig. „Starbucks“ kennen wir
Deutschen bereits, aber auch die lokale Variante, die Kaffeehauskette „Peet's Coffee“, unterscheidet sich nicht sehr in der Atmosphäre. Müßiggang wird in Amerika eben nicht so hoch geschätzt. Deshalb sitzen die meisten Leute
im Café am Laptop oder nehmen den Kaffee gleich mit auf den Weg.
„To go“ muss hier auch das Essen sein, weil Amerikaner, so haben es
Will und Kendra mir erklärt, nicht gerne tatenlos sind. Essen kann
man auch nebenbei. Arbeit wird zwar hoch bewertet, aber noch mehr
geht es darum, immer aktiv zu sein.
Das gilt auch für die
Freizeit. Deshalb arbeiten Kinder an „projects“ (obwohl sie einfach nur basteln) und viele
Erwachsene treiben unermüdlich Sport.
Ich war noch nicht in den
Hipster-Clubs von San Francisco, aber schaue ich die Leute auf den
Straßen meines neuen Lebensmittelpunktes an, wird Kleidung hier
anscheinend nicht so hoch bewertet. Sie muss meistens praktisch sein.
Omas mit Turnschuhen? Männer, die auf der Arbeit Bermuda-Shorts
tragen? Warum nicht! Die Kleidung ist zudem meist schlecht aufeinander abgestimmt, die Farben oder Materialien passen beispielsweise nicht zueinander. Eine Schuhverkäuferin empfahl Falk sogar,
Outdoor-Sandalen zu kaufen und dann Trainingssocken anzuziehen, weil
es morgens sehr kalt sein kann! Das nennt man dann "casual" (ungezwungen).
Aussehen der Person (und Arbeitszeiten) werden in Amerika viel weniger vorgeschrieben als in
Deutschland, schließlich zählt das Endergebnis der Arbeit!
Obwohl die Kleidung so leger sein darf, ist es für eine Amerikanerin undenkbar, ungeschminkt aus dem Haus zu gehen. Entsprechend angemalt sehen selbst die Muttis aus, die ihre Kleinen auf den Spielplatz begleiten, und es gibt nur wenige Ausnahmen. (Ich gehöre hier ja schon längst zu den Hippies ...)
Unter den Europäerinnen,
die ich in Berkeley kennen gelernt habe, herrscht die Meinung, dass amerikanische Waschmaschinen nicht viel Wert sind.
„Erwarte nicht, dass die Wäsche nach dem ersten Waschen sauber
ist!“, wird einem mit auf den Weg gegeben. Mehrmals waschen und
dann in den Trockner, ist anscheinend der gangbare Weg. Ich hänge
unsere Wäsche aber meistens auf den Balkon (Sonne gibt es kostenlos und in Kalifornien von April bis Oktober eigentlich jeden Tag). Damit reihe ich mich in die neue Bewegung der
amerikanischen Ökos ein, die manche Errungenschaften in der Hausarbeit
ablehnen, weil sie schlecht für die Umwelt sind.
Aber selbst wer hier
Ökowaschmittel kauft oder mit Ökospülmittel putzt, wird immer von
einem extremen Duft benebelt. Die Bio-Marke, die ich auch in
Deutschland verwende, riecht hier wirklich penetranter! Ganz zu
schweigen von den herkömmlichen Drogerieprodukten (selbst bei Baby-
und Damenhygieneartikeln), aber diesen Trend gibt es ja leider auch in
Europa.
Auf der anderen Seite kaufen - zumindest in der San Francisco Bay Area - wesentlich mehr Leute Bio-Lebensmittel ein. Und
Bio-Supermärkte haben keineswegs diese Ausstrahlung wie in
Deutschland, dass man sich etwas fremd vorkommt, wenn man nicht zum
eingeschworenem Publikum zählt. Nein! Die große
Bio-Supermarkt-Kette „Wholefoods“ macht aus dem ökologischen
Lebensstil eine Unterhaltung, manche Filialien bieten sogar
Kochkurse an. Es gibt eine Suppen- und Salatbar für Gerichte zum
Mitnehmen. Sowieso ist die Auswahl riesig und der Laden für unsere
Verhältnisse natürlich sehr groß. (Einen gesonderten Eintrag zu amerikanischen Supermärkten werde ich in Kürze einstellen.)
Auch in Nicht-Bio-Läden
gibt es hier keine Plastikbeutel an der Kasse und schon gar nicht
kostenlos. Entweder man bekommt eine braune Papiertüte für 10 bis
35 Cent oder einen wieder verwendbaren Beutel aus recycelten
Materialien für einen Dollar (Stoffbeutel habe ich allerdings noch
nicht gesehen). San Francisco war meiner Information nach die erste
Stadt in den USA, die Plastikbeutel verboten hat. Das wäre doch einmal eine wirklich sinnvolle Vorschrift, die die Europäische Union übernehmen sollte!
Und wenn es schon um
Papier geht: Ich weiß nicht warum, aber es gibt in Amerika kein
ordentliches Toilettenpapier. Die Klopapierrollen sind so
dermaßen dünn, dass … Ich will nicht näher darauf eingehen. Auch amerikanische Taschentücher sind so hauchzart, dass sie keinen Heuschnupfen
überleben. Es gibt nur die Stärke der Kleenex-Box-Tüchlein.
Deshalb bunker ich meine Tempos aus Deutschland.
Nachts sreite ich mich mit meinem Mann um die Bettdecke. Denn in unserem "queen-size-bed" (152 mal 203 Zentimeter), das eigentlich zu schmal für zwei Personen, aber zu groß für eine Person ist, hat auch die Decke entsprechende Maße. Als Paar teilt man in Amerika eben nicht nur Tisch und Bett, sondern auch die Bettdecke (ähnlich wie beispielsweise in Frankreich). Die Decke ist zwar riesig, aber Deutsche haben ja schon ein besonderes Verhältnis zu bauschigen Federbetten, in die sie sich einkuscheln ... Zu zweit geht das nur, wenn man frisch verliebt ist. Zum Glück haben wir ein zweites Schlafzimmer, in das Falk dann manchmal ausweicht, wenn es im Ehebett zu eng wird.
Und bevor mir noch mehr Unterschiede einfallen, höre ich jetzt lieber auf.